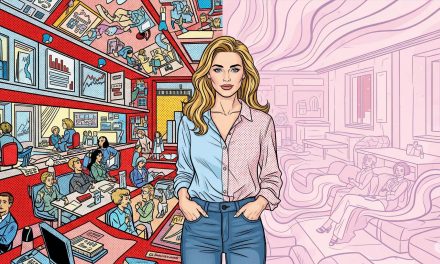Viele Menschen kommen ins Coaching mit dem Wunsch, unangenehme Gefühle wie Angst, Wut oder Hilflosigkeit loszuwerden. Doch je mehr wir versuchen, diese Emotionen zu kontrollieren oder zu unterdrücken, desto stärker werden sie. Unser Körper reagiert, der Druck steigt, und die innere Anspannung wächst.
Gefühle sind keine Störfaktoren – sie sind Signale. Sie zeigen uns, was uns wichtig ist, wo wir verletzlich sind und welche Bedürfnisse unerfüllt bleiben. Genau hier setzt der NARM™-Ansatz an: nicht, um Gefühle „wegzumachen“, sondern um Menschen wieder mit sich selbst zu verbinden.
Wie Gefühle entstehen – und warum frühe Erfahrungen wichtig sind
Unsere Fähigkeit, Emotionen wahrzunehmen und zu regulieren, entwickelt sich in den ersten Lebensjahren – lange bevor wir Sprache oder ein Bewusstsein für unsere Gefühle haben.
Kinder lernen über Beziehung, welche Gefühle „erlaubt“ sind. Erwachsene reagieren manchmal mit Überforderung oder Distanz („Reiß dich zusammen“). Das Kind lernt, Gefühle zu verdrängen oder abzuspalten – eine Anpassung, die später im Leben zu innerer Leere, Angst oder Selbstzweifeln führen kann.
Der Neurobiologe Gerald Hüther beschreibt: Emotionale Selbstregulation entsteht durch Resonanz – durch Verbindung, nicht durch Kontrolle. Genau hier setzt NARM™ an.
Der NARM™-Ansatz: Verbindung statt Optimierung
NARM™ (Neuroaffektives Beziehungsmodell) nach Dr. Laurence Heller bietet einen tiefgreifenden Weg, Emotionen zu verstehen. Im Coaching geht es nicht darum, Gefühle zu beseitigen. Stattdessen lernen Menschen:
- Wie zeigt sich ein Gefühl im Körper?
- Welche Bedeutung hat es im Hier und Jetzt?
- Welches Bedürfnis oder Schutzmechanismus liegt darunter?
Veränderung entsteht, wo wir bewusst mit uns selbst in Kontakt kommen – nicht durch Analyse, sondern durch Erfahrung.
Ein Praxisbeispiel: Angst vor öffentlichem Sprechen
Eine Klientin kam mit der Angst, vor Menschen zu sprechen. Sie wollte, dass die Angst verschwindet. Doch je mehr sie versuchte, sie zu kontrollieren, desto stärker wurde sie: Herzklopfen, Enge, Zittern.
Im Coaching geschah etwas Entscheidendes: Plötzlich brachte die Klientin biografische Szenen ein – Momente aus ihrer Kindheit, in denen sie sich abgelehnt oder nicht gesehen fühlte. Sie erkannte, dass die Angst vor öffentlichem Sprechen eng mit dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit verbunden war – zugleich wollte sie ihren eigenen Gestaltungsraum wahren.
Indem sie lernte, diese Scham und die Verletzlichkeit mit Mitgefühl zu betrachten, löste sich die Angst Schritt für Schritt. Es war keine Technik, die Veränderung bewirkte, sondern die neue Beziehung zu sich selbst: Akzeptanz wurde zur Basis für Lebendigkeit und Selbstbestimmung.
Die Dynamik hinter Gefühlen verstehen
Hinter offensichtlichen Emotionen wie Angst, Wut oder Hilflosigkeit verstecken sich oft verletzliche Gefühle: Traurigkeit, Sehnsucht, Bedürftigkeit. Schutzmechanismen, die früher lebenswichtig waren, können im Erwachsenenalter hinderlich sein.
NARM™ arbeitet ressourcenorientiert und sanft: Schutzmechanismen werden bewusst gemacht, nicht bekämpft. Nur wenn unser Nervensystem Sicherheit erfährt, kann echte Integration stattfinden – ein Ansatz, der auch die Erkenntnisse der Polyvagal-Theorie berücksichtigt.
Warum NARM™ heute relevant ist
In einer Zeit permanenter Reizüberflutung, Unsicherheit und Beschleunigung sind viele Menschen äußerlich funktional, innerlich aber abgeschnitten – von Körper, Gefühlen und Lebendigkeit.
NARM™ zeigt Wege, wieder in Kontakt mit sich selbst zu kommen, die eigenen Gefühle zu verstehen und eine achtsame Beziehung zu sich selbst zu entwickeln – auch in herausfordernden Situationen.
Fazit
NARM™-Coaching bedeutet nicht, sich zu verändern, sondern sich selbst wieder zu spüren. Es ist ein Prozess der Selbstbegegnung, jenseits von Kontrolle und Optimierung. Wenn wir aufhören, gegen unsere Gefühle zu kämpfen, und beginnen, ihnen zuzuhören, kehren wir zu unserer inneren Lebendigkeit zurück. Der Fokus liegt auf Verbindung, Verständnis und Selbstmitgefühl – Grundpfeiler, die für emotionale Stabilität und persönliche Entwicklung langfristig entscheidend sind.