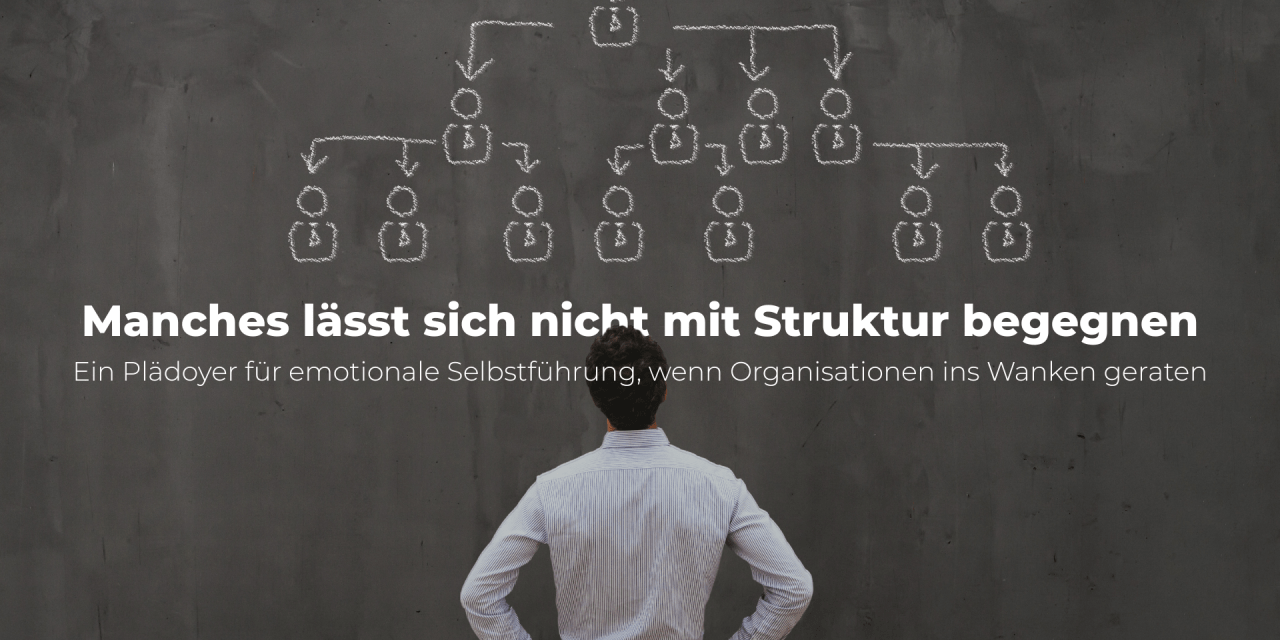Ein Plädoyer für emotionale Selbstführung, wenn Organisationen ins Wanken geraten
Je unsicherer die Lage, desto strukturierter der Reflex. Prozesse, Pläne, Zuständigkeiten. Wenn Organisationen unter Druck geraten, greifen sie gern zu dem, was greifbar scheint: Struktur. Und natürlich brauchen wir diese Struktur. Sie gibt Orientierung, sie schafft Rahmung. Aber manchmal, vielleicht gerade in Krisen, Übergangsphasen oder kulturellen Kipppunkten, hilft mehr Struktur nicht. Sie verschärft das, was sie eigentlich lösen soll: Orientierungslosigkeit.
Denn vieles, was in Organisationen als “fehlende Klarheit” erscheint, ist in Wahrheit nicht ein Mangel an Struktur, sondern ein Mangel an emotionaler Verbundenheit, an Resonanz, an Mut zur Unsicherheit. Hier greifen klassische Interventionen oft zu kurz. Was gebraucht wird, ist emotionale Selbstführung. Und zwar nicht als individuelles Coaching-Thema, sondern als systemischer, kollektiver Lernweg.
Wenn Struktur kippt: Die vier neurobiologischen Grundmotive
Was passiert mit Menschen, wenn in einer Organisation Unsicherheit aufkommt? Zur Orientierung im emotionalen Erleben beschreibt emTrace® vier motivationspsychologisch fundierte Grundmotive, die neurobiologisch verankert sind und in herausfordernden Systemen besonders relevant werden:
- Durchsetzung & Einfluss: Menschen wollen wirksam sein, gestalten dürfen, gehört werden. In instabilen Systemen kippt dieses Motiv schnell in Machtspiele, Mikromanagement oder Rückzug.
- Ordnung & Stabilität: Wenn Prozesse schwanken oder Rollen unklar werden, sehnen wir uns nach Struktur, Kontrolle und Planbarkeit. Dieses Motiv dominiert besonders in Phasen organisationaler Neuorientierung.
- Harmonie & Geborgenheit: Wir wollen dazu gehören, nicht ausgeschlossen sein. Wenn Teams emotional dysreguliert sind, entstehen Misstrauen, Konfliktscheu oder Scheinharmonie.
- Inspiration & Leichtigkeit: Kreativität, Vision und Entwicklung brauchen Offenheit. Doch unter Druck verlieren wir den Zugang zu diesem Grundbedürfnis oft zuerst.
Diese vier Motive wirken in jedem von uns, in jedem Team und in jeder Organisation. Und sie geraten unter Spannung, wenn die strukturelle Antwort auf emotionale Komplexität zu eindimensional bleibt.
Was Strukturen können und was nicht
Struktur ist nicht schlecht. Sie schafft Orientierung, schützt vor Chaos, gibt Form. Aber Struktur allein kann keine Emotion regulieren. Sie ersetzt keine Resonanz. Sie kontrolliert keine Unsicherheit: sie überspielt sie.
Eine Führungskraft kann noch so klar kommunizieren, wenn das Team innerlich im Fluchtmodus ist. Ein Organigramm kann Zuständigkeiten regeln, aber keine Konflikte auflösen. Ein KPI kann Leistung messen, aber keine Zugehörigkeit erzeugen.
Emotionale Selbstführung heißt, genau das zu erkennen. Und, systemisch betrachtet, heißt sie auch: Führen in Ungewissheit. Nicht ausweichend, nicht überstrukturiert, sondern mit Haltung.
Was es braucht: Gleichzeitigkeit
Die zentrale Kompetenz in dynamischen Organisationen ist nicht Kontrolle. Sondern Ambiguitätstoleranz. Die Fähigkeit, Unsicherheiten zu halten und trotzdem handlungsfähig zu bleiben. Das gelingt nur, wenn Struktur und emotionale Intelligenz nicht gegeneinander stehen, sondern sich gegenseitig stützen.
Ein Team braucht Struktur. Und es braucht Leichtigkeit. Es braucht Rollen und Beziehung. Es braucht klare Ziele und das gemeinsame Aushalten von “Ich weiß es gerade auch nicht.”
Emotionale Selbstführung ist der innere Muskel, der genau das trainiert: Standhalten, benennen, verbinden, handeln. Und manchmal heißt das: innehalten, bevor man strukturiert. Fühlen, bevor man plant. Atmen, bevor man bewertet.
Fazit
Manches lässt sich nicht mit mehr Struktur begegnen. Aber vieles lässt sich mit mehr Verbindung tragen. Wenn unsere neurobiologischen Grundmotive in Balance sind: wenn wir uns wirksam, sicher, zugehörig und inspiriert fühlen, steigt unser Wohlbefinden. Und was für uns als Individuum gut ist, kann für Organisationen nicht schlecht sein.
Vielleicht ist der nächste Schritt nicht mehr Planung. Sondern ein Moment des Innehaltens. Ein ehrliches Gespräch. Eine Frage. Und dann erst Struktur.