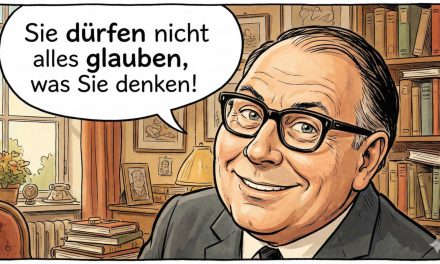…und Amateure versuchen alles allein. Führungskräfte stehen täglich unter Druck. Sie treffen Entscheidungen, tragen Verantwortung– und das oft unter harten Bedingungen. In solchen Berufen ist es nicht nur sinnvoll, sondern essenziell, regelmäßig innezuhalten, das eigene Handeln bewusst zu reflektieren und zielgerichtet Entlastung herbeizuführen. Damit stärkt es unsere Resilienz, bevor sie gebraucht wird. Doch leider hält sich in vielen Köpfen hartnäckig das Vorurteil: Wer Unterstützung sucht, sei schwach. Dabei ist das Gegenteil der Fall.
Supervision: Ein professionelles Werkzeug, kein persönliches Defizit
Jeder Athlet im Leistungssport hat einen Kreis von handverlesenen Experten um sich herum: verschiedenste Trainer, Mediziner, Physiotherapeuten usw. Im Fußball würden viele den Nationaltrainer wohl verbannen, wenn nach einem Spiel keine Auswertung (Reflektion) stattfinden würde…
In der Politik oder im Management ist es nicht anders. „Physische“ Experten weichen diversen Beratern. Der Blick von oben und der Impuls von außen wird notwendig. Engstirnig „in der eigenen Suppe zu kochen“ bringt eben nicht voran.
Blick und Impuls von außen wird durch Supervision bzw. Coaching erreicht, je nachdem welches Wording verwendet wird.
Supervision ist dabei eine strukturierte Form der beruflichen Reflexion. Als besondere Beratungsform bietet sie Raum, um Erfahrungen zu verarbeiten, Konflikte zu besprechen und die eigene Rolle im Team zu klären. Besonders in Berufen mit hoher emotionaler Belastung ist sie ein zentraler Baustein für langfristige Gesundheit und Leistungsfähigkeit.
Klarheit schafft Kapazität für Neues
Orientieren wir uns am bekannten Kapazitäten-Modell der Flugpsychologie (nach Richter), dann stellen wir erneut fest: was innere Kapazität frisst, hemmt den vollen Aktionsradius, die volle Ressourcenaktivierung. Ähnlich einem nicht aufgeräumten Zimmer: unter nie aufgeräumten Gegenständen und angesammelten Müll und Staub finden wir die entscheidenden Gegenstände im entscheidenden Moment nicht.
Daher ist Supervision (Coaching) ein bewährtes Mittel in menschenzentrierten Berufen, in denen mentale Kapazitäten berufsimmanent in „Beschlag“ genommen werden UND Entscheidungsstärke verlangt wird. Ob wir aufräumen oder in unserer inneren Unordnung ersticken, ist eine Frage der professionellen Haltung.
Dabei achten Führungskräfte häufig nicht auf ihren eigenen Zustand, sind entweder zu sehr aufgaben- oder zu sehr mitarbeiterzentriert. Außenorientierung. Was vergessen wird, sind sie selbst. Fehlende Innenorientierung. „Mit Vorbild weiter machen“ auch wenn es hart wird, geht eben solange gut, bis die Fehlerrate steigt, die Zufriedenheit und Leistung sinkt, oder das Notaus kommt. Was für ein Vorbild…
Moment mal, begriffliches Feintuning – oder Rebranding?
Man kann durchaus argumentieren, dass „Supervision“ oft einfach nur das ist, was im sozialen, therapeutischen oder öffentlichen Sektor als Coaching bezeichnet würde – nur mit einer Prise akademischer Gravitas und einem traditionsreichen Anstrich. Supervision klingt nach Tiefe, Reflexion und Methodenintegration. Coaching dagegen nach Zielorientierung, Effizienz – und gelegentlich auch mal nach Scharlatanerie. Wobei Super- Vision, also das Sehen aus der Adlerperspektive und Über- Blick verschaffen nicht immer in die Tiefe gehen muss, aber durchaus Ziel sein kann.
Die Grenzen zwischen Coaching, Therapie, Beratung und Supervision sind dabei fließend, sodass selbst Fachleute manchmal ins Stolpern geraten, wenn man sie um eine saubere Trennlinie bittet.
Aber was passiert wirklich im Raum? Oft: dieselben Interventionstechniken. Beide Formate bedienen sich meist systemischer Fragestellungen, nutzen Methoden wie zirkuläres Fragen, Ressourcenorientierung oder Visualisierungen. Viele Supervisoren bieten auch Coaching an – und umgekehrt.
Das Etikett sagt nicht alles
Supervision wird meist durch Organisationen beauftragt, ist eingebettet in Qualitätsmanagement oder Gesundheitsförderung – das heißt: sie hat häufig einen institutionellen Anker.
Je nach Ausbildung/ Erfahrung/ Stil, sind Supervision und Coaching 2 Seiten derselben Medaille wie es so schön heißt.
Was sagt die Forschung?
Inhaltlich sind die empirischen Studien oft gar nicht so eindeutig. Eine Metastudie der Universität Kassel (2020) hat z. B. festgestellt, dass es keine konsistenten Wirkungsunterschiede zwischen Coaching und Supervision auf psychologische Parameter (Stressreduktion, Rollenklarheit etc.) gibt – wohl aber unterschiedliche Erwartungen und Wahrnehmungen seitens der Teilnehmenden.
Kritisch formuliert: Die Unterschiede sind teils traditionell, teils institutionell gewachsen – aber selten substantiell. Am Ende geht es darum zu reflektieren und was daraus gemacht wird: entwickeln oder stagnieren?
Reflexion als Führungsqualität
Berufliche Reflexion ist nicht nur ein individuelles Werkzeug, sondern auch ein Führungsinstrument. Führungskräfte, die regelmäßig reflektieren – sei es im Einzelcoaching oder in Teamsupervisionen – treffen fundiertere Entscheidungen, kommunizieren klarer und fördern ein gesundes Arbeitsklima. Das wiederum führt zu leistungsfähigeren Teams und stressresistenten Mitarbeitern.
Laut einer Untersuchung der Elisabeth-Kübler-Ross-Akademie (2020) ist ein stabiles Team mit guter Kommunikation der wichtigste Schutzfaktor gegen psychische Belastungen. Supervision trägt maßgeblich dazu bei, diese Teamstabilität zu fördern.
Denkanstoß:
Welcher Handwerker würde seine Werkzeuge nach dem Gebrauch achtlos liegen lassen und wild im Werkzeugkoffer herumpurzeln lassen?
Wenn viel Kopfarbeit geleistet wird, oder schwerpunktmäßig auch emotional verarbeitet wird, warum sollten wir da unsere Werkzeuge nicht auch pflegen? Niemand würde einem Handwerker vertrauen, der seine Werkzeuge zum Feierabend lieblos in die Ecke wirft, nicht reinigt und nur die billigsten Baumaterialien verwendet. Also fragen wir uns lieber, was ist unser Handwerk und wie pflegen wir unsere Werkzeuge? In unserer verdichteten und schnelllebigen (Arbeits-) Welt ist das essentiell. Und wer viel mit Kopf und Herz arbeitet, der sollte diese Werkzeuge pflegen…
Der Mythos der Unverwundbarkeit
Die Erfahrung zeigt: Verantwortungsträger sind keine „außergewöhnlichen Menschen“. Nur ihre Berufsrealität ist außergewöhnlich. Warum also hält sich das Vorurteil, dass nur „Schwache“ Support brauchen? Ein Grund liegt in der tradierten Vorstellung des „unerschütterlichen Helden“. „Wenn wir nicht stark sind, wer soll es sonst sein?“ Doch diese Vorstellung ist nicht nur überholt, sondern gefährlich. Sie verhindert, dass Menschen sich Unterstützung holen – und erhöht sogar das Risiko für Burnout oder Depressionen! Und damit ist genau das Gegenteil eingetreten, was ursprünglich beabsichtigt war. Erneut können wir uns nun also die Frage stellen „Wenn wir nicht stark sind, wer soll es sonst sein?“…
Die Realität ist: Wer reflektiert, schützt sich selbst – und damit auch andere. Denn wer klar agiert, statt in einem unaufgeräumten (inneren) Zimmer, kann auch sinnvolle Entscheidungen treffen, wenn es drauf ankommt. Und sind wir mal ehrlich: in belastungsintensiven Umfeldern kommt es immer drauf an. Wer sich also Unterstützung holt, handelt nicht aus Schwäche, sondern aus Verantwortung und damit letztlich aus Professionalität für die Aufgabe heraus.
Supervision als Teil der Organisationskultur
Damit Supervision/ Coaching wirksam sein kann, muss es Teil der Organisationskultur werden. Das bedeutet: Es darf nicht als „Notlösung“ bei Krisen verstanden werden, sondern als kontinuierlicher Bestandteil professionellen Handelns. Proaktiv, präventiv und begleitend. Es verhält sich gewissermaßen wie mit der körperlichen Fitness: wer keine Klimmzüge macht, wird auch nicht die Mauer hochklettern können, wenn Nachbars Hund hinter einem her ist…
Diese präventive und begleitende Herangehensweise ist entscheidend wie viele Führungskräfte langfristig sicher ihrer Verantwortung gerecht werden können, oder wann sie ausfallen und selbst zum „Problemfall“ werden.
Fazit: Stärke zeigt sich im Dialog, nicht im Schweigen
In einer zunehmend verdichteten Arbeitswelt, ist es höchste Zeit, umzudenken, wie wir mit Belastung umgehen! Supervision oder Coaching sind keine „weichen Themen“, sondern harte Faktoren für Qualität, Gesundheit und Professionalität. Wer sich Unterstützung holt, zeigt nicht Schwäche – sondern Mut, Weitsicht und Führungsstärke.
Denn: Profis haben Support-Teams. Amateure versuchen alles allein.