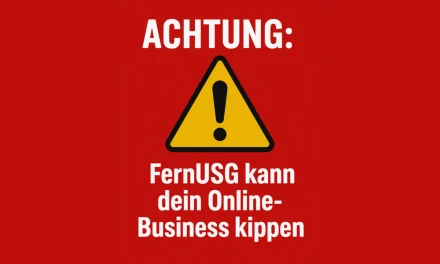In unserer Kultur ist Arbeit ein identitätsstiftender Faktor. Arbeit bietet soziale Sicherheit. Arbeit hat einen Einfluss auf die persönliche Lebenszufriedenheit, auf die psychische und körperliche Gesundheit. Deshalb ist Arbeitslosigkeit oder auch der gesetzlich verordnete Ruhestand für viele Betroffene ein Problem.
Den kulturellen Unterschied bezüglich des Stellenwerts von Arbeit habe ich eindrücklich erlebt, als ich mit meiner damaligen Partnerin in Kolumbien war. Ich wurde viel eingeladen und war auf Partys. Nie wurde ich gefragt, was ich beruflich mache; das hat mich am Anfang irritiert. Bei den Frauen hatte man dann gute Karten, wenn man Salsa tanzen konnte. In lateinischen Kulturen, die nicht überversichert sind wie bei uns, ist immer wieder mal ein Familienmitglied arbeitslos. Dann wird gemeinsam für den Betroffenen gesorgt, bis er wieder eine Arbeit hat. Das heißt, der Mensch wird nicht nach dem geschätzt, was er tut, sondern was er ist.
Wann kann ein Job toxisch werden?
Wenn der Stress hoch ist, es viele Frustrationsmomente gibt, Mitarbeiter inkompetent geführt werden, es Mobbing oder Schikane durch den Chef gibt, dann hat das einen Einfluss auf die psychische Belastung der Arbeitnehmer. Dann kann ein Job toxisch werden. Die Digitalisierung der Arbeitswelt hat auch einen Teil dazu beigetragen, dass sich viele Menschen von ihrer Arbeit überfordert fühlen. Ein Indikator ist die alte Therapeutenweisheit: „Nachts meldet sich die Seele.“ Das kann man sich wie eine mentale Müllabfuhr vorstellen. Wer schlecht schläft, wen die Arbeit in der Nacht heimsucht, der hat einen toxischen Job – egal, ob die Träume neutral oder belastend sind. Auch Gedankenkreise vor dem Einschlafen sind ein Warnsignal.
Was können Menschen tun, die merken, dass ihnen die Arbeit nicht guttut?
Die Ausgangslage ist unterschiedlich. Mein erster Tipp ist, zu schauen: Wie viel Zeit habe ich im Laufe eines Tages, in der ich wirklich abschalte? Keine elektronischen Medien, keine Tätigkeit, die mich geistig fordert. Wer genügend Zeit hat, sollte sich am Tag mindestens eine halbe Stunde Zeit zur mentalen Entspannung nehmen. Dazu helfen mentale Techniken wie Autogenes Training. Noch besser und wirksamer ist Selbsthypnose. Die maßgeschneiderte Selbsthypnose für Entspannung und besseren Schlaf kann bei mir elektronisch bestellt werden – zum Download auf das Smartphone.
Manchmal ist nicht der Job das Problem, sondern die Person, die ihn ausführt
Weil manchmal nicht der Job das Problem ist, sondern die Person, die ihn ausführt. Viele Menschen ignorieren, dass sie ihre Lebensgeschichte zu jedem Arbeitgeber mitnehmen. Sie machen sich nicht klar, dass sie ein Teil des Problems sind. Kaum einer will das hören. Wichtig wäre, sich erst mal seelisch zu stabilisieren, belastbar zu werden. Wer gut aufgestellt ist, sollte schauen, ob er seine Arbeitsbedingungen positiv verändern und mitgestalten kann. Niemand muss unter der Schikane seines Chefs leiden – also HR einschalten oder sich eine Lösung mit den Kollegen überlegen. Genauso muss niemand dauerhaft überfordernde Arbeitsbedingungen aushalten.
Und wenn alle Versuche scheitern?
Es gibt auch Menschen, die sich von Beginn an den falschen Job ausgesucht haben. Beispiel: jemand mit großem kreativem Potenzial, der stupide Verwaltungsarbeit erledigt. Wer permanent auf dem falschen Spielfeld unterwegs ist, muss sich nicht wundern, wenn das Spiel keinen Spaß macht. Das Spielfeld kann auch durch den Schiedsrichter, sprich Chef, negativ beeinflusst werden. Das habe ich erlebt, als mein damaliger Chef „Mikromanagement“ machte. Meine Arbeit ist mir total verleidet, ich hatte keinen Bock mehr, es hatte mich nicht mehr interessiert. Am Schluss kam es zur Kündigung – das habe ich als Befreiung erlebt, und ich ging in die Selbständigkeit als Job-Coach.
Wie sehr kann ein toxischer Job Menschen denn schädigen – schlimmstenfalls?
Es beginnt schleichend. Anfangs zeigen sich typische Stresssymptome, also erhöhter Blutdruck, Magen-Darm-Probleme, Schlafprobleme. Irgendwann liegen die Nerven blank. Dann beginnt eine Abwärtsspirale, die kaum aufzuhalten ist. Betroffene kommen mit den Arbeitsanforderungen immer weniger zurecht, reagieren ungünstig. Oft kommt es zum sogenannten Kompensationsverhalten: Die Arbeit macht krank, deshalb greifen Menschen beispielsweise zu ungesunder Ernährung, Alkohol oder Drogen. Am Ende steht entweder der seelische Bankrott – also Depressionen – oder der psychosomatische.
Nicht die Jobs werden toxischer, sondern die Menschen dünnhäutiger, weniger resilient
Dass der Körper reagiert: Jemand hat zum Beispiel so starke Migräne oder so heftige Rückenschmerzen, dass er nicht mehr arbeiten kann. Wichtig ist: Jede Form der Erkrankung ist eine Schutzreaktion des Körpers und der Seele.
Wie verhindert man, in einen toxischen Job zu rutschen?
An erster Stelle steht die seelische Stabilität. Wer schwierige Erlebnisse aus der Vergangenheit nicht verarbeitet hat, der wird eher in ungünstige Arbeitsbedingungen rutschen. Zweiter Punkt: Man sollte sich einen Job suchen, der zu einem passt. Es gibt so viele Möglichkeiten, einen passenden Job zu finden – man muss nur suchen.
Und was sind weitere Schritte?
Wichtig ist auch eine erfüllende und stärkende Freizeit. Ich habe in der Beratung immer wieder Menschen getroffen, die unter ihren Jobs leiden, weil sie keine Option mehr zur Regeneration haben. Letzter Schritt: den Mut haben, Missstände frühzeitig anzusprechen und gemeinsam mit der Führungskraft Lösungen zu erarbeiten.
Sind toxische Jobs auch ein gesellschaftliches Problem? Stichwort: Leistungsdruck?
Ich glaube, nicht die Jobs werden toxischer, sondern die Menschen dünnhäutiger, weniger resilient. Ich habe in den 60er-Jahren Mechaniker gelernt. Die ersten 4 Wochen haben wir nichts anderes gemacht, als ein Stück Eisen am Schraubstock zu einem Würfel zu feilen – jeweils 4×5 Tage à 9 Std. Das heißt: 180 Std! Das wäre heute nicht mehr vorstellbar. Die Lehrlinge würden schon am ersten Tag davonlaufen. Ich glaube, in vielen Bereichen waren die Aufgaben schon immer sehr anspruchsvoll, und sie werden mit der Digitalisierung nicht einfacher, sondern intensiver durch die extrem schnelle Entwicklung der KI-Tools. Die Menschen haben aber verlernt, sich zu erholen.
Eigentlich kann Arbeit doch auch ein sehr erfüllender Faktor im Leben sein. Vielleicht sogar heilsam.
Arbeit kann glücklich machen, Arbeit kann Freude bereiten, Arbeit kann Energie geben. Trotzdem ist Arbeit keine Therapie. Wer mit diesem Anspruch an einen Job herangeht, wird enttäuscht werden. Es gibt einen Grund, warum Arbeit „Arbeit“ heißt – und nicht Freizeit. Arbeit wird dann als sinnstiftend erlebt und führt nachhaltig zu überdurchschnittlicher Leistung, wenn die Lebensmotive und die Anforderungen eine hohe Übereinstimmung haben. Um das herauszufinden, gibt es das Assessment mit dem LUXX-Profile.
Der Artikel basiert auf Focus Online vom 15.07.25 sowie eigenen Erfahrungen.