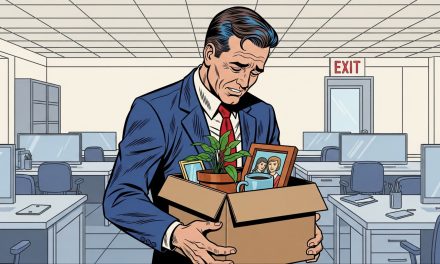Was ist Tuckmans Phasenmodell der Teamentwicklung?
Kennst du das? Ein neues Team startet voller Euphorie, dann kracht es plötzlich gewaltig, und du denkst: “Das wird nie was.” Genau diese Erfahrung hat Bruce Tuckman 1965 in seinem berühmten Phasenmodell beschrieben. Ursprünglich waren es vier Phasen – Forming, Storming, Norming und Performing – später kam noch eine fünfte dazu: Transforming.
Die gute Nachricht: Das Chaos ist normal. Sogar notwendig. Tuckmans Modell zeigt, dass Teams einen vorhersagbaren Entwicklungsweg durchlaufen. Und wenn du diesen Weg kennst, kannst du als Coach Teams dabei helfen, schneller und gesünder durch die schwierigen Phasen zu kommen.
Das Phasenmodell ist keine starre Abfolge, die Teams mechanisch abarbeiten. Es ist eher wie eine Landkarte, die zeigt, wo ihr gerade steht und was als nächstes kommen könnte. Manche Teams springen zwischen den Phasen hin und her, andere bleiben in einer Phase hängen. Aber die Grunddynamiken erkennst du immer wieder.
Phase 1: Forming – Die Höflichkeitsfalle
In der Forming-Phase sind alle noch auf Tuchfühlung. Die Teammitglieder lernen sich kennen, sind höflich zueinander und versuchen herauszufinden, worum es überhaupt geht. Oberflächlich betrachtet läuft alles harmonisch – aber das ist trügerisch.
Was du in der Forming-Phase erlebst:
- Alle sind motiviert und gespannt auf das Projekt
- Die Kommunikation ist höflich und oberflächlich
- Konflikte werden vermieden oder überspielt
- Die Rollen sind noch unklar
- Man orientiert sich stark an der Führungskraft oder dem Coach
- Entscheidungen werden nicht wirklich gemeinsam getroffen
Die Forming-Phase fühlt sich gut an, aber sie ist auch gefährlich. Viele Teams denken, sie seien schon ein echtes Team, weil es so harmonisch zugeht. In Wirklichkeit kennen sie sich noch gar nicht richtig.
Praxisbeispiel: Ein neues Projektteam in einer Werbeagentur soll eine Kampagne entwickeln. Alle nicken begeistert, wenn der Projektleiter seine Ideen vorstellt. Kritische Fragen werden nicht gestellt, weil niemand als Spielverderber dastehen will. Das Team fühlt sich super – bis drei Wochen später alles explodiert.
Phase 2: Storming – Willkommen in der Realität
Die Storming-Phase ist die härteste, aber auch die wichtigste Phase. Hier zeigen die Menschen ihr wahres Gesicht, Konflikte brechen auf, und die schöne Harmonie der Forming-Phase zerplatzt wie eine Seifenblase.
Typische Storming-Dynamiken:
- Konflikte um Arbeitsweisen und Prioritäten
- Machtkämpfe zwischen starken Persönlichkeiten
- Kritik an der Führung oder den getroffenen Entscheidungen
- Zweifel am Projekt oder den gemeinsamen Zielen
- Emotionale Reaktionen und persönliche Angriffe
- Cliquenbildung und Lagerdenken
Viele Teams und ihre Coaches bekommen in der Storming-Phase Panik. “Das Team funktioniert nicht!” ist ein häufiger Gedanke. Aber Storming ist kein Zeichen für Versagen – es ist ein Zeichen dafür, dass die Menschen anfangen, authentisch zu werden.
Die Storming-Phase kann Tage dauern oder Monate. Manche Teams bleiben sogar für immer darin stecken. Der Unterschied liegt daran, wie konstruktiv mit den Konflikten umgegangen wird.
Praxisbeispiel: Im Werbeteam bricht der Streit auf: Der Kreative findet die Ideen des Strategen langweilig, die Projektmanagerin ist genervt vom chaotischen Arbeitsstil des Kreativen, und der Texter fühlt sich übergangen. Plötzlich wird alles infrage gestellt – die Kampagne, die Termine, sogar die Berechtigung des Projektleiters.
Phase 3: Norming – Regeln finden, die für alle funktionieren
Wenn ein Team die Storming-Phase überlebt hat, kommt das Norming. Hier entwickeln die Teammitglieder gemeinsame Spielregeln und Arbeitsweisen. Die Konflikte sind nicht verschwunden, aber es gibt jetzt Wege, konstruktiv damit umzugehen.
Was in der Norming-Phase passiert:
- Gemeinsame Standards für Kommunikation und Zusammenarbeit entstehen
- Rollen und Verantwortlichkeiten werden klarer
- Ein “Team-Gefühl” entwickelt sich
- Unterschiede werden akzeptiert statt bekämpft
- Feedback-Kultur entsteht
- Entscheidungsprozesse werden etabliert
Die Norming-Phase ist oft geprägt von intensiven Gesprächen. Das Team reflektiert, was in der Storming-Phase passiert ist, und entwickelt bewusst neue Vereinbarungen. Oft entstehen hier auch emotionale Momente – Entschuldigungen, neue Wertschätzung füreinander, gemeinsame Aha-Erlebnisse.
Praxisbeispiel: Das Werbeteam setzt sich zusammen und spricht offen über die vergangenen Konflikte. Sie entwickeln gemeinsame Regeln: Der Kreative bekommt mehr Freiraum für seine Arbeitsweise, dafür hält er die abgesprochenen Termine ein. Der Stratege erklärt seine Ideen verständlicher, bekommt aber auch ehrliches Feedback zu deren Umsetzbarkeit. Die Projektmanagerin führt tägliche Kurz-Meetings ein, die allen helfen, den Überblick zu behalten.
Phase 4: Performing – Jetzt läuft der Motor
In der Performing-Phase funktioniert das Team wie ein gut geölter Motor. Die Zusammenarbeit ist eingespielt, Konflikte werden konstruktiv gelöst, und die Ergebnisse stimmen. Hier entstehen die Sternstunden der Teamarbeit.
Merkmale der Performing-Phase:
- Hohe Produktivität und Qualität der Arbeit
- Flexible Rollenverteilung je nach Situation
- Selbstorganisation funktioniert
- Konstruktiver Umgang mit Meinungsverschiedenheiten
- Unterstützung und Vertrauen untereinander
- Gemeinsame Verantwortung für Erfolg und Misserfolg
- Innovation und Kreativität entstehen
Die Performing-Phase ist das, was sich die meisten unter “gutem Teamwork” vorstellen. Aber sie ist kein Dauerzustand. Teams können wieder in frühere Phasen zurückfallen – besonders wenn sich die Rahmenbedingungen ändern oder neue Mitglieder dazukommen.
Praxisbeispiel: Das Werbeteam läuft wie geschmiert. Jeder weiß, was von ihm erwartet wird, aber alle sind auch bereit, über ihre Rolle hinauszugehen, wenn es nötig ist. Wenn ein Problem auftaucht, wird es direkt angesprochen und gelöst. Die Kampagne wird nicht nur termingerecht fertig, sondern gewinnt auch noch einen Preis.
Phase 5: Transforming – Das Ende als Neuanfang
Die fünfte Phase, das Transforming (früher auch “Adjourning” genannt), beschreibt die Auflösung des Teams. Das klingt traurig, ist aber ein natürlicher Teil des Teamzyklus. Projekte enden, Teams werden neu zusammengestellt, Menschen verlassen das Unternehmen.
Was in der Transforming-Phase wichtig ist:
- Bewusster Abschied vom gemeinsamen Arbeiten
- Reflexion über Erfolge und Learnings
- Wertschätzung für die gemeinsame Zeit
- Klärung offener Punkte
- Übergabe von Wissen und Erfahrungen
- Emotionale Verarbeitung des Endes
Die Transforming-Phase wird oft vernachlässigt oder hastig abgehandelt. Dabei ist sie wichtig für den emotionalen Abschluss und für die persönliche Weiterentwicklung der Teammitglieder.
Praxisbeispiel: Nach dem erfolgreichen Kampagnenabschluss nimmt sich das Werbeteam Zeit für eine ausführliche Retrospektive. Sie feiern ihre Erfolge, sprechen über das Gelernte und verabschieden sich bewusst voneinander. Viele der entwickelten Arbeitsweisen nehmen sie mit in neue Teams.
Wie du als Coach Teams durch die Phasen begleitest
Jede Phase braucht andere Interventionen von dir als Coach:
In der Forming-Phase hilfst du dabei:
- Klare Ziele und Erwartungen zu definieren
- Rollen und Verantwortlichkeiten zu klären
- Kennenlernprozesse zu vertiefen
- Oberflächlichkeit aufzubrechen
In der Storming-Phase unterstützt du durch:
- Konflikte moderieren statt vermeiden
- Emotionen ernst nehmen und kanalisieren
- Gemeinsame Basis trotz Unterschiede finden
- Durchhaltevermögen stärken (“Das ist normal!”)
In der Norming-Phase begleitest du bei:
- Vereinbarungen entwickeln und dokumentieren
- Feedback-Prozesse etablieren
- Team-Identität stärken
- Nachjustierungen der Regeln
In der Performing-Phase sorgst du für:
- Weiterentwicklung statt Stillstand
- Reflexion der Arbeitsweise
- Vorbereitung auf neue Herausforderungen
- Erhaltung der Team-Energie
In der Transforming-Phase hilfst du beim:
- Bewussten Abschied gestalten
- Learnings dokumentieren
- Wertschätzung ausdrücken
- Übergänge in neue Teams
Typische Fallen im Umgang mit dem Phasenmodell
Die größte Falle ist der Glaube, Teams müssten alle Phasen schnell durchlaufen. Manche Coaches versuchen, die Storming-Phase zu überspringen oder zu verkürzen. Das funktioniert nicht – die Konflikte kommen später umso heftiger zurück.
Eine andere Falle ist das mechanische Abarbeiten der Phasen. Tuckmans Modell ist ein Orientierungsrahmen, kein Rezeptbuch. Jedes Team ist anders und braucht individuelle Unterstützung.
Viele unterschätzen auch, dass Teams bei Veränderungen wieder in frühere Phasen zurückfallen können. Ein neues Teammitglied, ein geändertes Ziel oder ein neuer Chef – und schon bist du wieder beim Forming oder sogar Storming.
Wann Tuckmans Modell besonders hilfreich ist
Das Phasenmodell ist besonders wertvoll bei:
Neu zusammengestellten Teams: Wenn Menschen zum ersten Mal zusammenarbeiten, hilft das Modell dabei, realistische Erwartungen zu setzen.
Teams in der Krise: Wenn ein Team in Konflikten feststeckt, zeigt das Modell, dass das normal ist und wie es weitergehen kann.
Langzeitprojekten: Bei Projekten, die über Monate oder Jahre laufen, durchleben Teams oft mehrere Zyklen der Phasen.
Führungskräfte-Entwicklung: Manager lernen zu verstehen, dass ihre Rolle sich je nach Teamphase ändern muss.
Change-Prozessen: Wenn sich Organisationen verändern, fallen Teams oft in frühere Entwicklungsphasen zurück.
Die Grenzen des Phasenmodells
Tuckmans Modell ist hilfreich, aber nicht allgemeingültig. Manche Teams entwickeln sich spiralförmig, andere überspringen Phasen oder bleiben dauerhaft in einer Phase stecken. Virtuelle Teams oder sehr erfahrene Teams können auch ganz andere Entwicklungsverläufe haben.
Außerdem stammt das Modell aus den 1960ern und berücksichtigt moderne Arbeitsformen nur bedingt. Agile Teams, die in Sprints arbeiten, oder Teams mit stark wechselnder Besetzung passen nicht immer ins klassische Schema.
Das Modell kann auch als Ausrede missbraucht werden: “Wir sind halt in der Storming-Phase” rechtfertigt nicht destruktives Verhalten oder schlechte Führung.
Dein Team-Check: In welcher Phase steckt ihr?
Schau dir ein Team an, das du kennst oder begleitest:
Forming-Indikatoren:
- Höflichkeit steht über Ehrlichkeit
- Wenig kontroverse Diskussionen
- Orientierung an Autoritäten
- Unklarheit über Rollen und Ziele
Storming-Indikatoren:
- Offene oder versteckte Konflikte
- Infragestellung von Entscheidungen
- Emotionale Reaktionen
- Cliquenbildung
Norming-Indikatoren:
- Intensive Diskussionen über Zusammenarbeit
- Entwicklung gemeinsamer Regeln
- Stärkeres “Wir-Gefühl”
- Konstruktiver Umgang mit Unterschieden
Performing-Indikatoren:
- Hohe Produktivität
- Flexible Rollenverteilung
- Selbstorganisation funktioniert
- Konstruktive Konfliktlösung
Transforming-Indikatoren:
- Projekt-Ende in Sicht
- Reflexion über die gemeinsame Zeit
- Vorbereitung auf Trennung
- Übergabe von Verantwortung
Wo siehst du das Team? Und was braucht es, um zur nächsten Phase zu kommen?
Fazit: Der Weg ist das Ziel
Tuckmans Phasenmodell zeigt uns eine wichtige Wahrheit: Gute Teamarbeit entsteht nicht von selbst. Teams müssen sich entwickeln, und diese Entwicklung ist manchmal schmerzhaft. Aber genau das macht sie wertvoll.
Als Coach ist es dein Job, Teams durch diese Entwicklung zu begleiten – nicht um sie zu beschleunigen, sondern um sie bewusster und konstruktiver zu gestalten. Jede Phase hat ihre Berechtigung und ihre Geschenke.
Die Forming-Phase lehrt uns Neugier und Offenheit. Storming zeigt uns unsere Unterschiede und Grenzen. Norming hilft uns, Kompromisse zu finden und gemeinsame Wege zu entwickeln. Performing lässt uns erleben, was möglich ist, wenn Menschen wirklich zusammenarbeiten. Und Transforming lehrt uns, loszulassen und Neues zu beginnen.
Vielleicht ist das die wichtigste Erkenntnis: Ein Team zu sein bedeutet nicht, immer einer Meinung zu sein. Es bedeutet, gemeinsam durch alle Phasen zu gehen – durch die schönen und die schwierigen. Und genau das macht die Reise so lohnenswert.
Buchtipp
Ein häufig empfohlener Klassiker, der sich mit den Herausforderungen und Dysfunktionen in Teams auseinandersetzt, ist “Die 5 Dysfunktionen eines Teams” von Patrick M. Lencioni. Obwohl es nicht direkt Tuckmans Phasenmodell behandelt, beschreibt es in Form einer Fabel, wie eine Protagonistin die grundlegenden Defizite in der Teamarbeit erkennt und behebt, was thematisch eng mit der Teamentwicklung und den Phasen nach Tuckman verwandt ist.