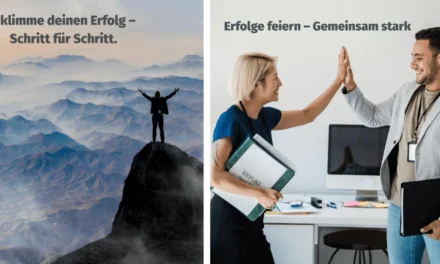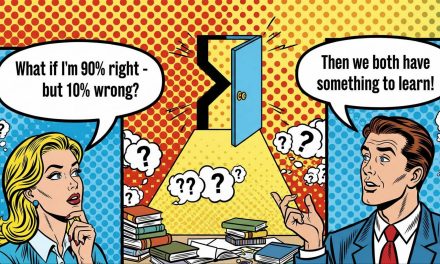Wie wir Hochsensibilität besser verstehen und warum es hilft, einen Unterschied zu kennen.
Viele Menschen kennen diesen Satz, ausgesprochen, unausgesprochen, gehört, erfahren, erlebt:
“Du bist einfach zu sensibel!”
Wer fein fühlt und stark reagiert, fragt sich irgendwann, woher diese Tiefe kommt.
“Ist das einfach meine Art zu sein, oder einen Folge von etwas, das mich geprägt hat?”
Um sich selbst und andere besser zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf zwei verschiedene Wurzeln:
- Angeborene Hochsensibilität, in der Forschung als Sensory Processing Sensitivity (SPS) bezeichnet und
- Erlernte Sensitivität, die sich aus wiederkehrender Belastung oder Trauma entwickeln kann.
Hochsensibilität — die angeborene Tiefe
Hochsensibilität ist keine Diagnose, sondern ein Temperamentsmerkmal, das rund 15–20% der Menschen betrifft.
Das Nervensystem reagiert dabei tiefer und differenzierter auf Reize. Studien zeigen, dass etwas 47% dieser Sensitivität genetisch veranlagt sind.
Neurowissenschaftlich belegt: Hochsensible Personen zeigen verstärkte Aktivität in Gehirnregionen, die für Empathie, Reizverarbeitung und soziale Wahrnehmung zuständig sind. Das bedeutet: Hochsensible Menschen nehmen mehr wahr, emotional, zwischenmenschlich, sensorisch.
Diese Tiefe kann im Berufsalltag zu einer echten Ressource werden: Feinfühlige Menschen erkennen Stimmungen im Team, unterschwellige Konflikte oder unausgesprochene Bedürfnisse oft früher als andere. Ihre Empathie, ihr Detailblick und ihre Reflexionsfähigkeit sind wertvoll wenn sie lernen, Energie und Reizintensität zu balancieren.
Wenn Sensibilität aus Schutz entsteht
Manche Menschen erleben Sensibilität als Last, nicht als Stärke. Sie sind ständig in Alarmbereitschaft, reagieren übermäßig stark auf Geräusche, Stimmungen oder Druck. Das kann nach außen wie Hochsensibilität wirken, ist aber oft etwas anderes: eine Schutzreaktion des Nervensystems nach Belastung, Überforderung oder Trauma. Traumaforschung zeigt, dass das Stresssystem sich dabei “umstellt”. Es bleibt wachsam, selbst wenn keine Gefahr mehr besteht. Die Form der Überempfindlichkeit ist erlernt, nicht angeboren und damit grundsätzlich veränderbar, wenn Sicherheit, Stabilität und emotionale Begleitung entstehen.
Im Arbeitskontext kann das bedeuten: Menschen mit traumageprägter Sensitivität brauchen klare Strukturen, transparente Kommunikation und Räume, in denen sie sich sicher fühlen dürfen. Sie bringen oft ein außergewöhnliches Gespür für Stimmungen mit, aber erst, wenn das System nicht im Dauerstress ist.
Warum es hilfreich ist, den Unterscheid zu kennen
Es geht nicht darum, Etiketten zu vergeben. Es geht darum, bewusster zu verstehen, was in uns reagiert und warum bzw. wozu. Wer weiß, dass seine Sensibilität biologisch angelegt ist, kann lernen mit ihr zu leben, statt gegen sie zu kämpfen. Und wer erkennt, dass sie aus Schutz entstanden ist, kann Wege finden, das Nervensystem Schritt für Schritt zu beruhigen.
Im Business-Kontext ist dieses Bewusstsein Gold wert: Führungskräfte, die ihre eigene Sensitivität oder die ihrer Mitarbeitenden verstehen, schaffen Umfelder, in denen Tiefe, Klarheit und Vertrauen wachsen können. Teams profitieren, wenn Emotionen nicht bewertet, sondern verstanden werden.
Wie du deinen Weg finden kannst
Reflexion hilft, den Ursprung deiner Sensibilität zu erkunden:
- Wann fühlst du dich überreizt? Und wodurch?
- Wann empfindest du Tiefe als Bereicherung?
- Welche Situationen bringen dich dauerhaft in Alarmbereitschaft?
Ein Tagebuch über Auslöser, Energie und Erholung kann Klarheit bringen. Auch der HSPS-Kurztest nach Aron (1997) bietet erste Orientierung.
Professionelle Begleitung, ob Coaching oder Therapie hilft, Sensibilität zu verstehen und in gesunde Bahnen zu lenken. Im Coaching kann der Fokus z.B. auf Selbstregulation, Energiemanagement und Grenzen liegen. In therapeutischen Settings geht es um die Heilung von Überlastung oder Trauma, wenn das Nervensystem selbst Schutz braucht.
Für Unternehmen und Führungskräfte
Sensibilität ist längst ein Faktor moderner Führung.
In diversen Teams bringt sie Balance zwischen Leistung und Achtsamkeit. Hochsensible Mitarbeitende reagieren oft stark auf Überlastung, aber auch besonders positiv auf unterstützende Umfelder: Ein Prinzip, das in der Forschung als Vantage Sensitivity beschrieben wird. Das bedeutet: Gute Rahmenbedingungen wirken bei sensiblen Menschen überproportional positiv. Ein achtsames Umfeld steigert Kreativität, Loyalität und emotionale Intelligenz. Fähigkeiten, die in der heutigen Arbeitswelt entscheidend sind.
Fazit
Hochsensibilität ist kein Trend, sondern Teil menschlicher Vielfalt. Manche Menschen werden mit einer tiefen Wahrnehmung geboren. Andere entwickeln sie, weil das Leben sie aufmerksam gemacht hat.
Beides ist echt.
Beides braucht Verstehen.
Und beides kann mit der richtigen Begleitung zu Stärke werden.
Quellen & weiterführende Literatur
- Aron, e. & Aron a. (1997): Highly Sensitive Person Scale (HSPS)
- Originalskala und theoretische Einführung in des Konzept der Hochsensibilität
- hsperson.com
- Lionetti, F. et al. (2024): Sensory Processing Sensitivity: A heritable and evolutionarily conserved trait
- Frontiers in Psychology
- Volltext lesen (Frontiers)
- Acevedo, B. et al. (2014): The Highly Sensitive Brain: An fMRRI Study. Brain & Behavior
- Pluess, M. & Belsky, J. (2013): Vantage Sensitivity: Individual Differences in Response to Positive Experiences.
- Psychological Bulletin
- Greven, C. et al. (2019): Sensory Processing Sensitivity in the Context of Environmental Sensitivity: A Critical Review and Developmental Framework. Neuroscience & Biobehavioral Reviews
- Current Opinion in Psychology (2022): Sensory Dysregulation and Trauma: Current Findings in Stress Neuroscience