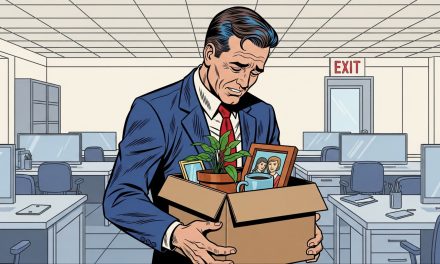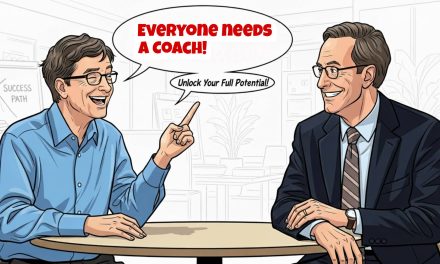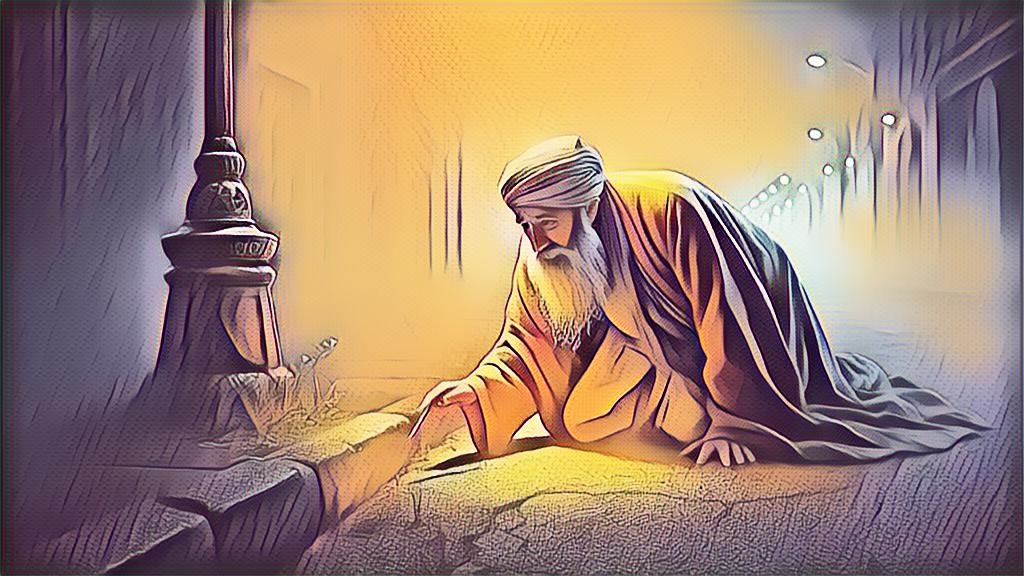Gefühle spielen eine zentrale Rolle in unserem Leben. Sie beeinflussen, wie wir denken, handeln und mit anderen interagieren. Dennoch werden sie im Coaching oft vernachlässigt, zugunsten kognitiver Ansätze oder strategischer Zielorientierung. Das Neuroaffektive Beziehungsmodell (NARM) zeigt, dass das bewusste Arbeiten mit Gefühlen ein Schlüssel für tiefgreifende und nachhaltige Veränderung ist – besonders im Coaching.
Warum Gefühle im Coaching wichtig sind:
- Gefühle als Signale: Gefühle sind nicht “gut” oder “schlecht” – sie sind Signale, die uns wichtige Informationen über unsere Bedürfnisse, Werte und Grenzen liefern (Damasio, 1999). Im Coaching geht es darum, diese Signale wahrzunehmen und zu verstehen.
- Gefühle und Handlungsmuster: Viele unserer Handlungen sind von unbewussten emotionalen Reaktionen geprägt. Indem wir diese Gefühle bewusst machen, können wir automatische Muster durchbrechen und neue Handlungsspielräume schaffen (Schore, 2003).
- Selbstregulation: Der bewusste Umgang mit Gefühlen fördert die Fähigkeit zur emotionalen Selbstregulation – eine Kernkompetenz für Führungskräfte und Changemaker (Siegel, 2012).

Wie NARM mit Gefühlen arbeitet:
NARM fokussiert darauf, Gefühle im Hier und Jetzt zu erforschen, ohne sie zu analysieren oder zu bewerten. Dabei geht es nicht nur um die Wahrnehmung von Gefühlen, sondern auch um die Erforschung der Beziehung zu diesen und den damit verbundenen Schutzstrategien und Identitätsmuster. Ziel ist es, die Verbindung zu sich selbst zu stärken und ein authentisches Erleben zu ermöglichen, indem emotionale Vervollständigung gefördert wird.
Ein zentraler Aspekt von NARM ist die Arbeit mit dem Spannungsfeld zwischen zwei Grundbedürfnissen:
- Das Bedürfnis nach Verbindung zu anderen und zu sich selbst.
- Das Bedürfnis nach Schutz, Zugehörigkeit und Autonomie.
Wenn diese Bedürfnisse in Konflikt geraten, entwickeln wir Schutzstrategien, die uns später blockieren können. Das bewusste Arbeiten mit diesen Dynamiken kann tiefe, nachhaltige Veränderungen bewirken.
Wissenschaftliche Grundlagen:
- Gefühle und Entscheidungsfindung: Laut Antonio Damasio sind Gefühle essenziell für gute Entscheidungen, da sie uns mit unseren Erfahrungen und Werten verbinden (Damasio, 1999).
- Emotionale Regulation: Allan Schore betont die Rolle der emotionalen Regulation für die Entwicklung von Resilienz und Beziehungen (Schore, 2003).
- Neurowissenschaften: Daniel Siegel zeigt, dass die bewusste Wahrnehmung von Gefühlen neurobiologische Veränderungen bewirken kann, die Selbstregulation und Klarheit fördern (Siegel, 2012).
Warum das für Coaching wichtig ist:
Coaching, das Gefühle einbezieht, geht über oberflächliche Zielerreichung hinaus.
Es ermöglicht:
- Klarheit und Authentizität: Wer seine Gefühle versteht, kann authentischer handeln und klarer kommunizieren.
- Resilienz: Emotionale Selbstregulation hilft, stressige Situationen souverän zu meistern.
- Nachhaltige Veränderung: Anstatt Symptome zu behandeln, arbeitet man an den zugrunde liegenden Mustern.
Fazit
Das bewusste Arbeiten mit Gefühlen, wie es in NARM integriert ist, macht Coaching zu einem kraftvollen Werkzeug für tiefgreifende persönliche und berufliche Entwicklung. Gefühle sind keine Hindernisse – sie sind der Schlüssel zu Wachstum und Authentizität.